28.06.2024 Doppelerfolg: Marburger Forschung wirbt Spitzenförderung des Landes ein
Neue LOEWE-Schwerpunkte für innovative Forschungsansätze in Mikrobiologie und Krebstherapie
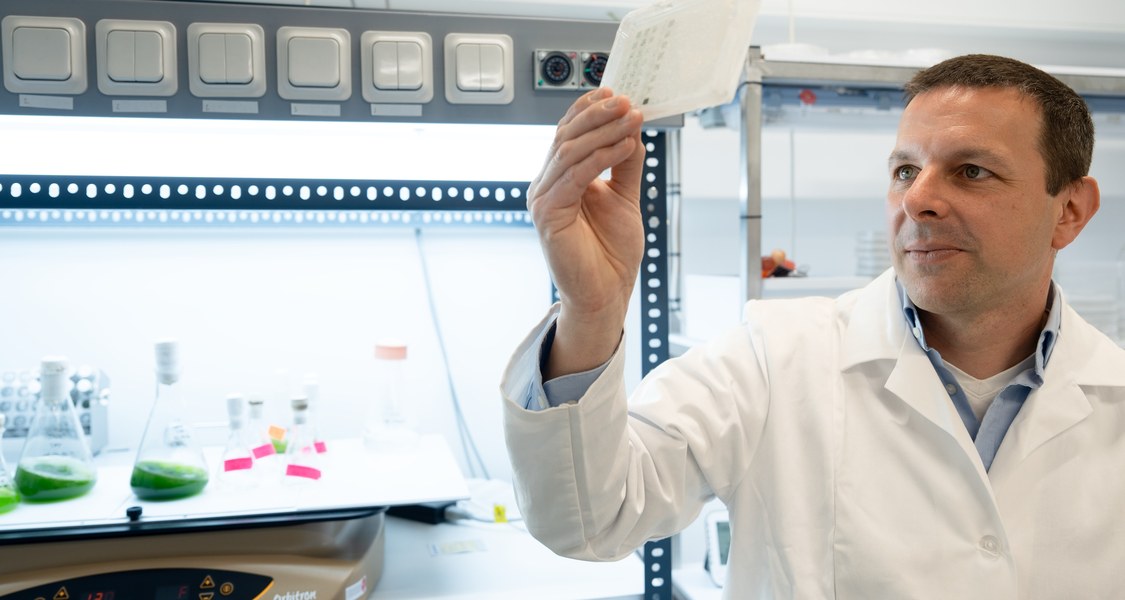
In der aktuellen Förderstaffel des hessischen Forschungsförderungsprogramms LOEWE ist die Philipps-Universität Marburg erneut erfolgreich: Sie hat einen neuen Schwerpunkt unter Marburger Federführung im Bereich der Mikrobiologie eingeworben und ist an einem zweiten geförderten Vorhaben zur Krebsforschung beteiligt.
„Ich gratuliere den beteiligten Wissenschaftler*innen herzlich zu diesem Erfolg und zur Anerkennung ihrer exzellenten Arbeit durch das Land Hessen. Durch die intensive Vernetzung zwischen Wissenschaft, außeruniversitärer Forschung und Wirtschaft sind tragfähige Partnerschaften entstanden, die im Verbund herausragende Ergebnisse in den beiden Marburger Profilschwerpunkten „Mikrobiologie, Biodiversität, Klima“ sowie “Entzündung, Immunologie, Tumorbiologie“ erwarten lassen“, betont Prof. Dr. Gert Bange, Vizepräsident für Forschung der Philipps-Universität.
Der biologischen Blaupause für einen nachhaltigen Kohlenstoff-Kreislauf auf der Spur
Im neuen LOEWE-Schwerpunkt „Robuste Chloroplasten für die natürliche und synthetische Kohlenstoff-Fixierung“, kurz RobuCop, suchen Forschende unter wissenschaftlicher Koordination von Prof. Felix Willmund nach neuen Lösungsansätzen für eine nachhaltige Zukunft. Sie erforschen die natürlichen Mechanismen der Umwandlung und Reduktion des klimaschädlichen Kohlendioxids und setzen durch künstliche Photosynthese neue Meilensteine für eine nachhaltigere Nahrungs- und Energieversorgung. Das Forschungsprojekt wird mit über 4,4 Millionen Euro für vier Jahre von 2025 bis 2028 gefördert.
Basierend auf den gewonnenen Erkenntnissen über natürliche Prinzipien sollen auf synthetischem Wege Enzyme optimiert und ganze Stoffwechselwege so in Mikroalgen und Pflanzenzellen integriert werden, dass sie Kohlendioxid robuster und effizienter umwandeln können. Chloroplasten sind die molekularen Fabriken für den Prozess der Photosynthese, also der Umwandlung von Kohlendioxid in Kohlenhydrate. Gleichzeitig sind sie jedoch empfindlich gegenüber Umweltstress, weswegen Pflanzen direkt vom Klimawandel betroffen sind. Die Folgen sind unter anderem verringerte land- und forstwirtschaftliche Erträge. RobuCop setzt genau dort an: es untersucht die molekularen Mechanismen, mit denen Chloroplasten auf Umweltveränderungen reagieren und etabliert neue Methoden, um in Chloroplasten mithilfe synthetischer Biologie einen nachhaltigen Kohlenstoff-Kreislauf zu implementieren. Dabei nutzt RobuCop neue und innovative Labortechniken im Bereich der Automatisierung und Robotik, die die industrielle Anwendung der Forschungsergebnisse ermöglichen wird. Am multidisziplinären Forschungsprojekt RobuCop arbeiten Expert*innen der Mikrobiologie, Chemie und Pflanzenwissenschaften zusammen. Ermöglicht wird dies durch das exzellente Zusammenspiel der Universität Marburg und dem benachbarten Max-Planck-Institut für terrestrische Mikrobiologie in der speziell dafür zugeschnittenen Forschungsinfrastruktur am Zentrum für Synthetische Mikrobiologie (SYNMIKRO). Felix Willmund, der Sprecher des RobuCop Konsortiums, ist ein renommierter Spezialist für molekulare Pflanzenwissenschaften und trägt zur Weiterentwicklung des profilbildenden Forschungsschwerpunkts „Mikrobiologie, Biodiversität, Klima“ an der Philipps-Universität bei. Seine Expertise bringt er zudem im beantragten Exzellencluster „Microbes for Climate“ ein, welches komplementär zu RobuCop aufgestellt ist. „RobuCop ist ein großartiges Beispiel für wissenschaftliches Teamwork. Gemeinsam können wir nun die Chloroplasten-Biotechnologie auf das nächste Level heben und einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten“, sagt Felix Willmund.
Innovative Krebs-Therapien weiter voranbringen

Im LOEWE-Schwerpunkt CARISMa erforschen Tumorspezialisten der Goethe-Universität Frankfurt und der Philipps-Universität Marburg gemeinsam mit weiteren Partnern eine neuartige Immuntherapie mit gentechnisch modifizierten körpereigenen Immunzellen, den sogenannten CAR-T-Zellen. Ziel ist es, CARTs auch gegen therapieresistente Krebsarten grundlegend weiter zu entwickeln. CARISMa wird die standortübergreifende Zusammenarbeit im onkologischen Spitzenzentrum UCT-Frankfurt-Marburg auf dem Zukunftsgebiet der modernen Zelltherapien stärken. Wissenschaftlicher Koordinator von CARISMa ist Prof. Dr. Thomas Oellerich vom Fachbereich Medizin der Goethe-Universität. Sprecher von CARISMa an der Philipps-Universität Marburg ist Prof. Dr. Andreas Burchert vom Fachbereich Medizin. Das Forschungsprojekt wird mit ca. 4,8 Millionen Euro für vier Jahre von 2025 bis 2028 gefördert.
Das Gebiet der Zelltherapie ist eines der dynamischsten Felder der modernen Hämatologie und Onkologie. Bei der CAR-Therapie werden patienteneigene Immunzellen durch das Einbringen des CAR-Vektors (CAR ist die Abkürzung für chimären Antigen-Rezeptor) genetisch so modifiziert, dass sie Tumorzellen gezielt erkennen und immunologisch abtöten können. Bei der Behandlung von Leukämien und Lymphomen hat die CAR-Therapie Erfolge erzielt, bei denen bisherige Therapien versagt haben. Sogenannte „solide“ Tumore wie bösartige Hirn-, Bauchspeicheldrüsen- und Darmtumore erweisen sich dagegen weitgehend resistent gegen diese Therapie.
Der neue LOEWE-Schwerpunkt „Optimierung von CAR-Zelltherapien durch Beeinflussung des ImmunSuppressiven Tumor-Mikromilieus“, kurz CARISMa, will nun zu einem besseren Verständnis beitragen, wie diese Resistenz der soliden Tumore zustande kommt und wie sie verhindert werden kann. Dazu wird erforscht, wie genau die CAR-T-Zellen mit dem Tumor und seinem Tumormikromilieu interagieren und wie neuartige CAR-Zelltherapien entwickelt werden können, die diese Resistenz überwinden. Dazu werden die Projektpartner, die bereits gemeinsam forschen, klinisch und experimentell stärker standortübergreifend und interdisziplinär zusammenarbeiten.