Hauptinhalt
Forschung am Institut für Klassische Sprachen und Literaturen
Begründen und Erklären im Antiken Denken
Von Sabine Föllinger herausgegebener Tagungsband erschienen

Die antike Philosophie hat unterschiedliche Formen von Begründung und Erklärung entwickelt, die für die Wissenschaftsgeschichte einflussreich waren. Diesen Ansätzen geht der von Sabine Föllinger in Zusammenarbeit mit Benedikt Löhlein herausgegebene Band nach. Er versammelt die Beiträge des 7. Kongresses der Gesellschaft für antike Philosophie (GANPH), der vom 4. bis 7. Oktober in Marburg stattfand. Sie umfassen die gesamte Zeit der griechisch-römischen Antike, von den Vorsokratikern bis in die christliche Spätantike. Dabei wird auch die Frage beleuchtet, in welchem Verhältnis Erklärungsansätze der Philosophie zu anderen Ansätzen, wie sie Epos, Tragödie, Geschichtsschreibung sowie Mythos und Religion entwickelten, standen. Auf diese Weise bietet der Band eine große Breite von Interpretationen unterschiedlicher Texte.
Leitfragen sind: Wie verlaufen Argumentationen in philosophischen und wissenschaftlichen Texten der Antike? Welche anderen Formen der Erklärung, etwa in Epos und Historiographie, gab es? Wo und warum integrieren philosophische und wissenschaftliche Autoren Formen nicht-wissenschaftlicher Erklärungen? Welche Formen von Wissenschaftstheorie gibt es, und welche Erklärungsmuster bieten sie?
Abgerundet wird das Themenspektrum durch einen Ausblick auf das Erklärungspotential narrativer Modelle aus der Sicht der Moderne.
Die Virtuose Niedertracht
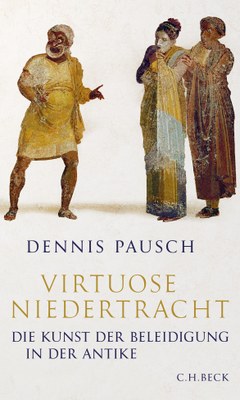
«Das Gesicht wie die Miene: Tod, Gelbsucht, Gift!» – «Du bist ein Lüstling, ein Vielfraß, ein Glücksspieler!» – Für die Antike waren dies noch sehr maßvolle Beschimpfungen. Selbst ein Virtuose des geschliffenen Wortes wie Cicero führte den schweren Säbel der verbalen Auseinandersetzung mindestens ebenso gern wie das elegante Florett. In diesem Band bieten die besten Lehrmeister Roms anhand zahlreicher Beispiele und ihrer Geschichten eine unterhaltsame Fortbildung in der Kunst der Beleidigung.
Dass ausgerechnet Cicero eines Tages klagte, in einer so schmähsüchtigen Stadt wie Rom zu leben (in tam maledica civitate), ist nicht frei von Komik. War doch der unumstrittene Meister der antiken Rhetorik zugleich ein Großmeister der Beleidigung. So bedachte er eines Tages einen politischen Gegner mit den Worten: «Du schwarzes Nichts, du Stück Kot, du Schandfleck»– und das war nur der Auftakt seiner Unfreundlichkeiten, die er für ihn parat hatte. Gleichgültig ob Politiker, Dichter oder Philosophen – sie alle wussten kräftig auszuteilen, wenn ihnen jemand in die Quere kam. Nicht einmal Verstorbene waren vor Beleidigungen sicher, wie etwa der verblichene Kaiser Claudius, dem Seneca nicht standesgemäß die Vergöttlichung, sondern stattdessen die Verkürbissung zuteilwerden ließ. Selbst der große Julius Caesar war nicht davor gefeit, Ziel wüstester Beleidigungen zu werden, wobei ihn gelegentlich sogar die eigenen Soldaten aufs Korn nahmen: «Städter, passt auf eure Frauen auf! Wir bringen den kahlen Buhlen. Dein Gold hast du in Gallien verhurt, hier hast du es geliehen. Dennis Pausch hat jedoch nicht nur ein «Best of» antiker Beleidigungen geschaffen, sondern erzählt stets auch die dazugehörigen Geschichten, wann und warum einst die verbale Keule kreiste. Entstanden ist ein ebenso informatives wie unterhaltsames und für Freunde der gepflegten (und auch weniger gepflegten) Beschimpfung inspirierendes Lesevergnügen.
Saving the Kashmirian Sanskrit Heritage
The importance of Kashmirian Sanskrit Literature was realised by scholars only in the late 19th century, when the literary canon and historiography of Sanskrit Literature in the Indian subcontinent had already taken shape. Texts and whole genres that were unique to Kashmir, as political history, were not properly recognised and led to a distorted view of South Asian literature. Much has changed, especially in the last decades, but the latest exodus and dissipation of the Kashmirian Hindu community is bound to have a lasting negative effect on such studies. A major effort to rescue the still unpublished and often unknown highlights of Kashmirian Sanskrit literature from oblivion is warranted.
In the present project a team specialising in editing Kashmirian texts will make a larger number of carefully selected texts accessible in first editions by utilizing the vast reservoir of Kashmirian manuscripts in India and Europe, but also scans that appeared online in recent years. Previous work on unknown texts from newly opened up archives has suggested that much more is to be discovered. One spectacular example would be a 17th century piece of visual poetry from Kashmir, the "Wish-fulfilling Tree" (kalpavṛkṣa), which is breaking several international records (for instance, for using thirty languages in its intexts), but has remained completely unknown until very recently. The project will produce a careful selection of previously unknown Kashmirian Sanskrit works in ten volumes. They will be accompanied by studies of their literary, religious or philosophical aspects, from which their significance for the history of Sanskrit Literature can be grasped. The project is a bold attempt to drastically improve the basis of scholarship in Kashmirian Sanskrit, and we shall argue that as a result new genres in Sanskrit literature need to be defined.
The project homepage can be found at https://www.kasaharaksa.de
Aristotle’s Generation of Animals. A Comprehensive Approach.
Aristotle’s work "On Generation of Animals" is fascinating. By integrating empirical facts into contexts of justification and by explaining reproduction in the framework of his general theory Aristotle wrote a biological ‘masterpiece’. At the same time it raises many issues because due to the difficulty of the subject under investigation (for example, the egg-cell had not yet been discovered) the theory is complex and often speculative.
The contributions in this volume resulting from a conference held in Marburg in 2018 study the challenging writing from various perspectives. They examine the structure of the work, the method and the manner of writing, its relation to other writings, and its scientific context. By investigating the underlying philosophical concepts and their relation to the empirical research offered in "On Generation of Animals" the contributions also try to solve puzzles which Aristotle’s explanation of the role of male and female offers as well as his idea of embryogenesis. An outlook for the history of reception rounds off the volume.
Aristoteles als wissenschaftlicher Autor
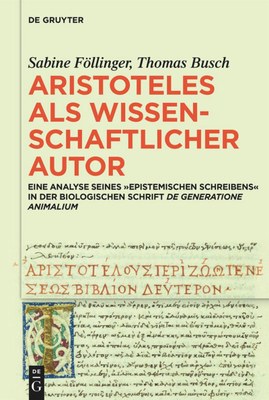
Wie arbeitet Aristoteles als wissenschaftlicher Autor? Wie nutzt er das Schreiben für seine Argumentation und ihre Darstellung? Dieser Frage geht die vorliegende Monografie für die Schrift De generatione animalium systematisch nach. In ihr entwickelt Aristoteles eine komplexe Theorie, mit der er Fortpflanzungs- und Vererbungsphänomene in der gesamten Tierwelt einschließlich des Menschen erklären möchte. Aristoteles‘ Argumentation ist dicht und wechselt zwischen Beweisführung, Diskursivität und Darstellung. Eine im Rahmen einer Makroplanung insgesamt prozessuale Vorgehensweise schließt die rhetorische Gestaltung einzelner Passagen nicht aus. Insgesamt kann gezeigt werden, wie Aristoteles das Schreiben nutzt, um auf innovative Weise die eigene Theorie zu entwickeln (‚epistemisches Schreiben‘) und gleichzeitig den Weg seiner Forschung zu vermitteln.
Mit der detaillierten Analyse der Bücher I-IV, der systematischen Auswertung der Ergebnisse und einem Katalog signifikanter Formulierungen bietet das Buch einen Ausgangspunkt und ein Instrumentarium für die weitere detaillierte Erforschung Aristotelischer Schriften und gleichzeitig einen Beitrag zur Geschichte der Wissenschaftsliteratur.
Glossing the Psalms
THE EMERGENCE OF THE WRITTEN VERNACULARS IN WESTERN EUROPE FROM THE SEVENTH TO THE TWELFTH CENTURIES

Glossen und Marginalien bilden einen der frühesten Zeugen der europäischen Volkssprachen: Aber wie wurden sie neben dem Lateinischen als der schriftlichen Standardsprache benutzt? Wie las man Texte in verschiedenen Sprachen zugleich, und warum? Die vergleichende Erforschung glossierter Handschriften bietet die Möglichkeit, die Sprachwahl der Schreiber in verschiedenen Teilen Europas zu analysieren. Daneben gilt es zu verstehen, wie Glossen in verschiedenen Sprachen neben sonstigen Schriftzeichen wie Interpunktion und Konstruktionshilfen benutzt wurden, und wie sie in die Seitengestaltung integriert sind. Erst vor kurzem hat die Forschung angefangen, den breiteren kulturellen Kontext dieser glossierten Handschriften zu berücksichtigen und Glossen und Marginalien als wichtige Zeugen für die Geschichte des Lesens und den mittelalterlichen Wissenstransfer in Westeuropa von der Spätantike bis ins Hochmittelalter zu betrachten.
Die komparatistische Herangehensweise von Prof. Blom verbindet historische Soziolinguistik mit Paläographie, Textphilologie, vergleichender Sprachwissenschaft und Kulturgeschichte. Damit versucht er, die frühe Schriftlichkeit in den keltischen und germanischen Sprachen innerhalb eines weiteren europäischen Horizonts zu verorten, insbesondere dort, wo sie in Gestalt von Glossen und Marginalien im Wechselspiel mit dem Lateinischen steht und sich als »multilinguales Lesen« gestaltet.
„Das Corpus der hethitischen Festrituale: staatliche Verwaltung des Kultwesens im spätbronzezeitlichen Anatolien“
Akademie-Langzeitprojekt an der Akademie der Wissenschaften und der Literatur | Mainz

Im Reich der Hethiter, das im 2. Jahrtausend vor Chr. im bronzezeitlichen Anatolien eine der wichtigsten Großmächte jener Zeit bildete, war der religiöse Staatskult ein wichtiges Anliegen der herrschenden Elite. Etwa ein Drittel der ca. 34.000 der Texte und Textfragmente, die aus den wieder ausgegrabenen Archiven der Hauptstadt Ḫattuša überliefert sind, lassen sich den Festritualtexten zuordnen. Diese bilden damit die größte Gruppe der hethitischen Texte. Notiert wurde in ihnen die kultische Verehrung der hethitischen Götter, die vorrangig dem hethitischen Königspaar und weiteren Mitgliedern der königlichen Familie oblag. Nach damaligem Verständnis war sie die Grundlage für das Wohlergehen des Staates: Wurden die Götter adäquat geachtet und mit Opfern versorgt, sorgten sie umgekehrt für den Schutz und das Wohlergehen der Königsfamilie und des gesamten Landes.
Das Langzeitprojekt der Akademie Mainz (2016-2036) besorgt eine Gesamtedition der hethitischen Festritualtexte und wird umfassende thematische Studien durchführen. Es ist an drei Arbeitsstellen, der Akademie in Mainz, der Philipps-Universität Marburg und der Julius-Maximilians-Universität Würzburg, mit jeweils unterschiedlichen Arbeitsschwerpunkten angesiedelt. Im Fachgebiet Vergleichende Sprachwissenschaft und Keltologie in Marburg steht die linguistische Erschließung der Texte im Zentrum. Fragestellungen betreffen etwa die Formelhaftigkeit der Sprache, fachsprachliche Merkmale und weitere pragmalinguistische und syntaktische Aspekte.
Wegen des erheblichen Umfangs des Materials sowie einer gewissen Gleichförmigkeit, die sich in sehr ähnlichen Schilderungen von Opfervorgängen widerspiegelt, ist häufig die sichere Zuordnung eines Fragments zu einem bestimmten Fest unmöglich. Deshalb wird das Corpus in seiner Gesamtheit zunächst digital erfasst. Anschließend wird es mit Metadaten versehen, um computergestützte Methoden und komplexe Suchen zur Zusammenstellung und Rekonstruktion der Texte nutzen zu können. Die hethitische Paläographie wird mittels innovativer digitaler Methoden auf ein neues Niveau gehoben und gleichfalls für die Textrekonstruktion nutzbar gemacht.
Für die großen und wichtigen Festrituale, darunter das KI.LAM-Fest, das nuntarriyašḫa-Fest und AN.DAḪ.ŠUMSAR-Fest sowie die Feste der Lokalkulte in den Städten Arinna, Nerik und Zippalanda, sollen web-basierte open access-Publikationen im Rahmen des „Hethitologie-Portals Mainz“ (www.hethiter.net) entstehen, die stets auf dem aktuellen Stand der Forschung gehalten werden und als print-on-demand-Editionen abrufbar sind. Darüber hinaus werden Anthologien weiterer ausgewählter Festbeschreibungen für die interdisziplinäre Forschung als Lesetexte gedruckt vorgelegt, ebenso wie übergreifende thematische Studien zur Religions- und Verwaltungsgeschichte, zur Paläographie und zur Sprache der Texte.
Für ausführlichere Informationen siehe http://www.adwmainz.de/projekte/corpus-der-hethitischen-festrituale/informationen.html.
Ein moderner Blick auf Platon
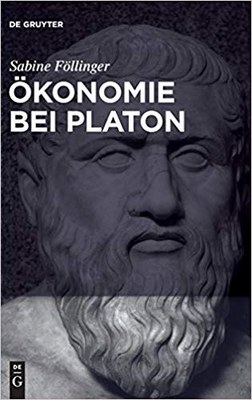
Hatte Platon, der ‚Übervater‘ der Philosophie, auch Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge? Dies hat man vielfach geleugnet. Doch eine genaue Lektüre seiner Dialoge ‚Politeia‘ und vor allem ‚Nomoi‘ zeigen, dass Platon von der Beobachtung wirtschaftlicher Prozesse ausgeht und im Rahmen seiner Anthropologie und politischen Philosophie daraus Schlussfolgerungen zieht. Ihnen geht das Buch nach, das das Resultat eines gemeinsam mit der Marburger VLW durchgeführten Projekts (Link zu diesem) entstanden ist: Da der Mensch nicht autark ist, ist er auf Austausch angewiesen. Austauschprozesse können auch im Sinne größerer Effizienz genutzt werden. Doch angesichts der menschlichen Neigung, immer mehr haben zu wollen, stellt der Bereich der Wirtschaft ein Risiko dar – aber nicht nur für das moralische Verhalten des einzelnen. Vielmehr erzeugt die ungleiche Verteilung von Gütern eine ‚soziale Schere‘ und damit Spannungen, die die Stabilität von Staat und Gesellschaft gefährden. Überdies führt die Verquickung von Wirtschaft und Politik dazu, dass politisch Verantwortliche nicht im Sinne des Gemeinwohls agieren. Darum muss der Bereich der Wirtschaft Reglementierungen unterliegen und darf politische Entscheidungen nicht beeinflussen.
Satire in der römischen Republik
Was Satire erlaubt ist und wo satirische Freiheit ihre Grenze findet, läßt sich nicht abstrakt und allgemeingültig beantworten. Streitigkeiten bis in jüngste Zeit zeigen, wie unterschiedlich die Grenzen in Abhängigkeit von kulturellen Traditionen und darin gründenden Rechtsordnungen gezogen werden. In den modernen europäischen Staaten wird in der Regel von zwei konkurrierenden Grundrechten ausgegangen: der Redefreiheit des einzelnen und dem Schutzanspruch von Institutionen, Personen oder Glaubensüberzeugungen.
Als Archeget der Gattung gilt die römische Satire, die indes eine Reihe von Problemen aufwirft, die z.T. seit langem sehr kontrovers diskutiert werden und nicht befriedigend gelöst sind. Das betrifft zum einen die Frage, ob die Satire tatsächlich eine römische Erfindung ist oder nicht: Die eine Hypothese führte zur Suche nach vorliterarischen Ursprüngen in Rom, die andere zum Identifikationsversuch satirischer Elemente in der griechischen Literatur, in deren Folge als eine Art Nebenprodukt eine Theorie des Satirischen entstand. Hinzukommt zum andern, daß das Satirische keineswegs mit der Gattung ‚Satire‘ identisch ist, diese vielmehr eine Fülle unsatirischer Elemente aufweist. Die Aporien sind nicht aufgelöst. Gleichwohl hat sich von daher ein literaturgeschichtliches Schema etabliert, das seit Casaubonus (1605) bis in die jüngsten Einführungen in die römische Satire weitgehend unverändert geblieben ist und das nach einem Kapitel zu vorliterarischen ‚Vorstufen‘ einen Vertreter der römischen Satire neben den anderen stellt und jeweils in einem eigenen Kapitel abhandelt. Doch das ist nicht wirklich befriedigend.
Das Projekt verfolgt daher einen anderen Ansatz. Es konzentriert sich dabei auf die römische Republik und bezieht auch die wissenschaftsgeschichtliche Seite der Fragestellung besonders in der frühen Neuzeit ein.


