22.04.2025 Call for Papers: Workshop "The Truth of Security, the Security of Truth"
Der Sonderforschungsbereich Transregio 138 "Dynamiken der Sicherheit" ruft zur Einreichung von Beitragsvorschlägen zum Thema "The Truth of Security, the Security of Truth: Erkundungen der Wechselbeziehung von Wahrheits- und Sicherheitsfragen" auf. Die Veranstaltung findet am 26. und 27. November an der Philipps-Universität Marburg statt. Die Frist für die Einreichung von Beitragsvorschlägen ist der 30. Juni 2025.
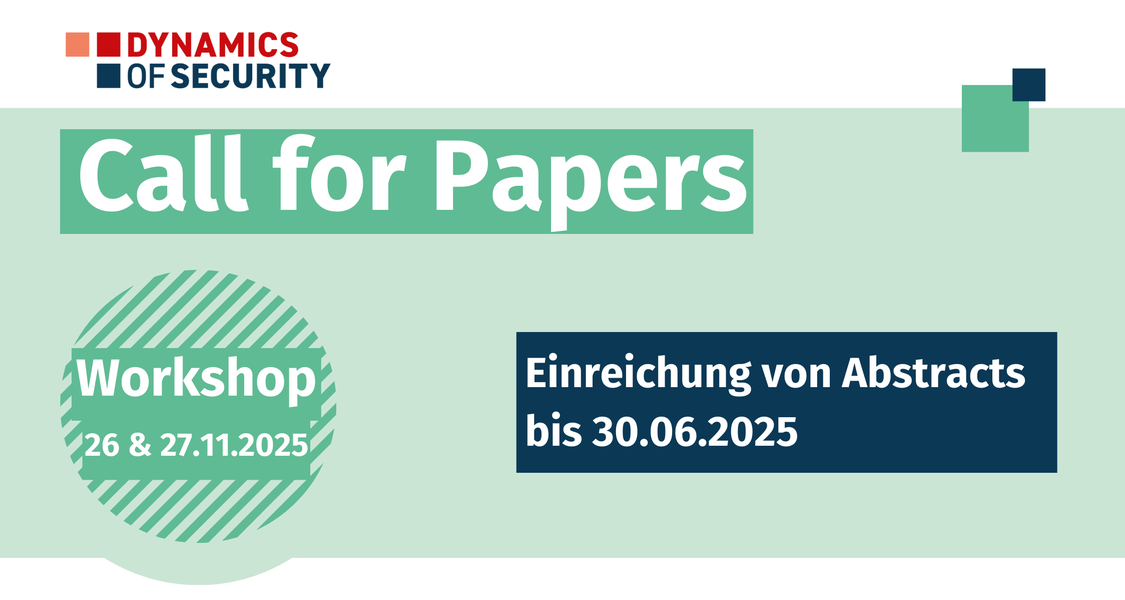
Thema des Workshops
Gegenwärtig lassen sich eine zunehmende Verschränkung und wechselseitige Durchdringung von Semantiken der Sicherheit mit Semantiken der Wahrheit beobachten. Diese zeigen sich unter anderem in der Versicherheitlichung von Fragen (politischer) Wahrheit – wofür etwa die Post-Truth-Debatte zahlreiche Beispiele bereithält (Kleeberg 2019) – sowie in den Bedrohungslagen der jüngeren Zeit. So zeichnete sich etwa die Sicherheitspolitik der COVID-19-Pandemie durch eine umfangreiche Mobilisierung wissenschaftlicher Expertise aus, während gleichzeitig die Frage der Zirkulation von Falschinformationen zu einem relevanten Problem wurde. Umgekehrt werden Fragen politischer Sicherheit aber auch zunehmend zum Prüfstein des Korrespondenzbezugs einer ‚realistischen‘ (im Unterschied zu einer ‚ideologischen‘) Politik. Man denke nur an die jüngsten politischen Rufe, sich in der Außen- und Sicherheitspolitik den ‚neuen Realitäten‘ zu stellen (Kohler 2025).
Vor diesem Hintergrund überrascht es, dass die Debatten der kritischen Sicherheitsforschung zu Problematiken der Sicherheit und die kulturwissenschaftliche Diskussion zu Problematiken von Wahrheit sich bislang aufeinander beziehen. Zwar hat sich die kritische Sicherheitsforschung in den letzten Jahren nicht zuletzt durch ihre Öffnung zu den Studies of Governmentality und den Science & Technology Studies verstärkt mit wissenschaftlichen Wahrheitspraktiken der Versicherheitlichung beschäftigt, allerdings ohne den Blick für andere Formen des Wahrsprechens zu öffnen. Auch die Diskussionen über doing truth und Post-Faktizität sind bisher weitgehend ohne einen Bezug auf kritische Sicherheitsforschung ausgekommen. Dabei lassen sich eine Reihe von Ähnlichkeiten und Schnittstellen identifizieren.
In theoretischer Hinsicht zeigen sich Analogien in sozial- und kulturwissenschaftlichen Debatten zu Wahrheit und zu Sicherheit. So gehen Ansätze des doing truth im Anschluss an Foucault davon aus, dass Wahrheit nicht (allein) durch eine zutreffende Realitätskorrespondenz konstituiert wird (Krasmann 2019), sondern einen „sozialen Operator“ (Kleeberg/Suter 2014) darstellt, der Szenen (die Beichte, die Enthüllung etc.) und Figuren (die Journalistin, der Richter etc.), die Wahrheit hervorbringen, konfiguriert. In ähnlicher Weise geht die Securitization Theory davon aus, dass Sicherheitslagen sich nicht allein (und teilweise gar nicht) durch faktische Bedrohungslagen bilden, sondern durch autorisierte Sprechakte oder Praktiken. ‚Wahrheit‘ wie ‚Sicherheit‘ können somit als „Anrufungskategorien“ (Schober/Langenohl 2015: 11) verstanden werden, die in ihrer Sinnstruktur einen Bezug zur Realität außerhalb ihrer selbst voraussetzen und transportieren, analytisch jedoch nicht primär bzw. nicht allein durch diesen Bezug zu verstehen sind.
Enger betrachtet offenbaren sich konzeptuelle Parallelen zwischen einer „Sicherheitssituation“ (SFB/TRR 138) und einer „Wahrheitsszene“ (Kleeberg/Suter 2014). Beide kommen durch bestimmte Heuristiken und Repertoires bzw. Sozialfiguren und Praktiken zustande. Gemeinsam ist ihnen oftmals eine Dringlichkeitsunterstellung – bei Sicherheit im Kontext der Wahrnehmung einer Bedrohung, bei Wahrheit im Kontext einer Moralisierung des Geltungsanspruchs auf Faktizität (Langenohl 2014a). Gleiches gilt für einen Vereindeutigungs- und Positionierungsdruck, der von der Anrufung sowohl von Sicherheit wie von Wahrheit ausgeht: bei Sicherheit in Bezug auf die Identifikation der Bedrohung und der Bedrohten, bei Wahrheit durch die Dramatisierung von Korrespondenz mit den Fakten.
Epistemologisch zeichnen sich Sicherheit wie Wahrheit durch ein Übersetzungsdilemma aus. Keine Übersetzung kann für sich beanspruchen, alleinig, vollständig und ohne Modifikationen einen Inhalt aus einer Sprache in eine andere zu transferieren – und dennoch operiert jede Übersetzung auf der Grundlage des normativen Prinzips, dass ein solcher Transfer grundsätzlich möglich ist (Langenohl 2014b: 94). Keine Anrufung von Wahrheit kommt ohne die Bezugnahme auf Faktizität aus, auch wenn keine Aussage allein auf der Grundlage dieser Korrespondenz die Qualität einer Wahrheit annehmen kann. Gleiches gilt für Sicherheit: Eine Sicherheitsanrufung impliziert zwingend die Bezugnahme auf ein faktisches Sicherheitsproblem und bleibt dennoch ein Konstrukt. Dieses Übersetzungsdilemma gewinnt bei Sicherheit und Wahrheit politische Bedeutsamkeit, weil beide Dringlichkeit und Moralität aufrufen und Positionierung einfordern. Damit hängt ein weiteres epistemologisches und letztlich politisches Dilemma zusammen: Wie können Sicherheit und Wahrheit im Plural gedacht und praktiziert werden? In puncto Wahrheit wird diese Frage beispielsweise durch dekoloniale Ansätze angestoßen, die von knowledges im Plural sprechen, allerdings ohne bislang zu einem zufriedenstellenden Vorschlag gelangt zu sein, wie die Relation zwischen diesen „Wahrheiten“ zu denken oder zu praktizieren wäre (außer als Machtkampf und Positionierung in einem pluriverse, s. Mignolo 2011). Mit Bezug auf Sicherheit stellt sich die analoge Frage, wie die Sicherheitsanliegen unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen zueinander epistemologisch und politisch ins Verhältnis gesetzt werden könnten, ohne dass es auf ein dezisionistisches Nullsummenspiel hinausläuft.
Schließlich zeigt sich eine Parallele hinsichtlich der affektiven Gelingensbedingungen von Sicherheits- und Wahrheitspraktiken. Das Gelingen von Sprechakten und Praktiken der Sicherheit hängt neben einer Mobilisierung von Wahrheit maßgeblich von der Etablierung einer affektiven Resonanzstruktur ab, die sich etwa in Form von Angst, Gefühlen der Verunsicherung oder Pressuren der Dringlichkeit manifestiert. Affekte werden als politische Technologien mobilisiert und kanalisiert, um Bedrohungslagen als solche erfahrbar und relevant zu machen (Massumi 2015, O’Grady 2019). Ohne diese affektive Dimension scheint es deutlich schwieriger zu sein, überhaupt jemanden von einer Notlage zu überzeugen, weshalb nicht zuletzt auch in jüngeren Debattenbeiträge der politischen Ökologie auf die Notwendigkeit der Mobilisierung von Affekten hingewiesen wird (Latour/Schultz 2022). Umgekehrt unterhalten auch Wahrheitsoperationen eine enge Beziehung zur Logik des Affekts. Das zeigt sich zum Beispiel in der enormen Arbeit, mit der Wissenschaftler versuchen, den Zweifelnden „in die Ecke zu treiben und ihn mit immer dramatischeren visuellen Effekten zu umgeben“ (Latour 2006: 280). Der Einsatz zahlreicher medialer Darstellungstechniken ist also eine wesentliche Voraussetzung für die Gelingensbedingungen von Wahrheitsoperationen.
Vor diesem Hintergrund möchten wir diese beiden bisher nebeneinander laufenden Diskussionsstränge miteinander ins Gespräch bringen. Ziel des projektierten Workshops ist es, die skizzierten Überschneidungsflächen und Synergien genauer auszuloten, aber auch Differenzen und Reibungsflächen zu identifizieren. Wir freuen uns deshalb über Beitragsvorschläge, die diese Aufgabe angehen.
Folgende Fragen und Themen können hierbei adressiert werden:
- Wie lassen sich Praktiken der Sicherheit und der Wahrheit theoretisch wie konzeptionell aufeinander beziehen?
- Wie hängen Sicherheitssituationen mit Praktiken des Wahrsprechens zusammen und wie hat sich dieses Verhältnis historisch entwickelt?
- Welche Formen des Wahrsprechens (wissenschaftlich, rechtlich, ökonomisch, religiös?) werden von Sicherheitsdeutungen mobilisiert und wie tragen Sicherheitslogiken umgekehrt zur Konstituierung/Differenzierung sozialer Felder bei?
- Auf welchen Sicherheitslogiken beruhen Wahrheitspraktiken und welche Affekte der Sicherheit werden durch sie bedient?
Wir bitten um die Einreichung von Abstracts (ca. 300 Worte) bis zum 30. Juni 2025 an:
Andreas Langenohl (andreas.langenohl@sowi.uni-giessen.de)
Thilo Marauhn (thilo.marauhn@recht.uni-giessen.de)
Leon Wolff (leon.wolff@staff.uni-marburg.de)
Kontakt
Dr. Leon Wolff



